Väter und Söhne - Eine deutsche Tragödie


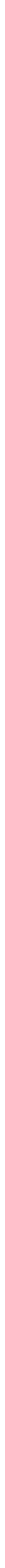
Homepage • Vita • Kinofilme • Fernsehfilme • Bücher • Operninszenierungen • Alf Brustellin • Kontakt

Das Drama einer Verführung





Mitte der fünfziger Jahre hat, wie Gerd Bucerius kürzlich berichtete (bezogen auf 1986 - Anm. der Red.), einer der damaligen Verleger die „Zeit" verlassen, weil er es nicht mehr verantworten wollte, dass die Verbrechen der Nazi-Zeit immer noch das Blatt beschäftigten. Zehn Jahre nach Kriegsende müsse nun endlich Schluss sein.
Als 1978 in der ARD die Frage diskutiert wurde, ob, wann und wo man die amerikanische Fernsehproduktion "Holocaust" senden wolle, war die Mehrheitsmeinung, dass man dies den deutschen Zuschauern eigentlich nicht mehr zumuten könne. Mehr als dreißig Jahre nach Kriegsende hätten die Menschen ein Recht darauf, mit diesen Dingen nicht mehr behelligt zu werden.
Eberhard Fechners „Majdanek-Prozess" 1985, Claude Lanzmanns „Shoa" 1986: Vierzig Jahre danach und immer noch kein Ende? Die „Gnade der späten Geburt" oder die „Arroganz der Spätgeborenen" – was gilt? Bei der westdeutschen Erstaufführung des Defa-Films „Ehe im Schatten", ein jüdisches Schauspielerschicksal in der Nazi-Zeit behandelnd, war Premierengast Veit Harlan zu Beginn des Jahres 1948 („Meine Partei ist die Kunst") schockiert darüber, dass ihn ein empörtes Publikum aus dem Saal buhte. In der Tat hatte er kollegiale Gründe, der Veranstaltung beizuwohnen: Komponist Wolfgang Zeller hatte nicht nur die Musik für „Ehe im Schatten" geschrieben, sondern wenige Jahre zuvor auch die für „Jud Süß".
Historische Nähe begründet nicht unbedingt auch geschichtliches Bewusstsein. Im Gegenteil. Claude Lanzmann erinnerte kürzlich daran, dass Jean-Paul Sartre 1946 in seinen „Reflexions sur la question juive" den Holocaust nur ganz am Rande erwähnt. Das Ungeheuerliche braucht Abstand, um in den Blick zu geraten, nicht nur für die Täter, auch für die Opfer und jene, die an ihrer Seite standen. Wo die Kräfte der Verdrängung wirken, hat die Erinnerung keine Chance.
Im I.G.-Farben-Prozess 1947/48 mussten sich die führenden Männer der deutschen Chemie-Industrie wegen Teilnahme an Kriegsverbrechen verantworten. Soweit sie überhaupt verurteilt wurden, waren die Strafen gering. Nach ihrer Verbüßung kehrten die Herren an ihre Arbeitsplätze zurück und machten das Wirtschaftswunder. Ohne Verdrängung hätte das deutsche Volk vermutlich nicht weiterleben können. Kann es dies auch ohne Erinnerung?
Aus der unmittelbaren Nachkriegszeit stammt der fatale Begriff von der „Bewältigung der Vergangenheit", insinuiert er doch etwas ganz und gar Unmögliches (was gibt es da zu „bewältigen"?) und verweist zugleich als Aufgabe an die Medien, wozu man in der Wirklichkeit weder fähig noch bereit war. Die Chance der Erinnerung wurde zur lästigen Pflicht herabgemendelt und so in die Nischen einer Bewusstseinsindustrie verwiesen, die sich immer schon besser auf das Geschäft der Verdrängung verstanden hat.
In den Filmen der fünfziger Jahre (die schon in den späten Vierzigern begonnen hatten) kam die Nazi-Zeit nicht vor – freilich auch die eigene Wirklichkeit nicht. In beidem unterschieden sie sich nicht von den Filmen der dreißiger Jahre. „Die gute Laune ist ein Kriegsartikel", hatte Joseph Goebbels konstatiert. Sie bewies ihre Nützlichkeit auch für den Frieden. Es waren zum großen Teil ohnehin die gleichen Regisseure, die hier und da für Stimmung sorgten. Schon 1945 hatten sich in Hamburg acht führende Regisseure versammelt, um den Wiederaufbau des deutschen Films zu planen, unter ihnen auch der ehemalige Chef der Ufa, Wolfgang Liebeneiner, und Veit Harlan. In der Bemühung um Kontinuität unterschied man sich nicht von der Chemieindustrie, und auch nicht in der Unbekümmertheit, mit der die Frage nach Schuld gar nicht erst erlaubt wurde. Im Rausch des Wiederaufbaus konnte die Gesellschaft auf die Agenten der Massenmedien vertrauen. Selbst tief verstrickt in die Ereignisse der Nazi-Zeit, war ihr Interesse gering, sich auf den Dialog mit der Geschichte einzulassen. Die Angelegenheit wurde angesichts des wachsenden Wohlstandes auf die einfachste und schmerzloseste Weise erledigt, mit Geld.
Der Wandel kam mit dem Fernsehen. Eine neue Generation von Autoren und Regisseuren sah in diesem, von den Kräften des Marktes unabhängigen Medium die Chance für eine andere Art von Film: wirklichkeitsnah, wahrhaftig, kritisch. Die kulturrevolutionäre Bewegung der zweiten Hälfte der sechziger Jahre zerriss auch den Nebelvorhang, der sich vor die Vergangenheit geschoben hatte. Die Söhne forderten die Auseinandersetzung heraus, der sich die Väter bis dahin entzogen hatten.
Seitdem sind viele Filme gedreht worden über diese Zeit, im Fernsehen und außerhalb, gute und weniger gute, strenge und anrührende. Kein anderes Thema hat die Phantasie der Filmenden in den letzten zwanzig Jahren so nachhaltig bewegt. Freilich hat sich auch nirgendwo sonst Geschichte als so ergiebig erwiesen für die Dramen der Leinwand.
Auf eine merkwürdige Weise blieb eine wichtige Gruppe bisher unberührt, obwohl ihre Verstrickung in den Faschismus interessanter, weil komplizierter war als die anderer Teile der Gesellschaft: die Wirtschaft, die Bourgeoisie. Irgendwie hatte man sich daran gewöhnt, den Nationalsozialismus als einen Aufstand des Kleinbürgertums zu definieren – das Großbürgertum sah zu und schwieg. Die Wirklichkeit, wir wissen das längst, sah anders aus. Die Wirklichkeit orientierte sich an den Interessen. „Interessengemeinschaft" war der zutreffende, aber etwas spröde Titel des Exposés, aus dem dann Jahre später der Film „Väter und Söhne" wurde. Es war während des Schnitts am „Felix Krull", dass Sinkel zum ersten Mal von dem Plan berichtete, in der eigenen Biographie die Spuren der Geschichte aufsuchen zu wollen. In den Akten des Nürnberger I.G.-Farben-Prozesses von 1947/48 lag das Material verborgen, auf das die Erzählung hinsteuern würde. Von Anfang an aber sollte der Bogen weiter sein, an die Wurzeln rühren. Größe und Elend der deutschen Industrie, oder eines Teils von ihr, über zwei Weltkriege hin.
Und nicht um Stahl sollte es gehen, nicht um Krupp, mit dem in zwei Kriegen deutsche Industrie international verknüpft worden war. Hatte doch die deutsche Chemie schon in den Anfängen dieses Jahrhunderts Weltrang wie heute. Eine Elite von Wissenschaftlern und Managern hatte das aufgebaut und durch frühe Konzernbildung die Macht gefestigt. Wie konnte es geschehen, dass die führenden Kräfte dieser Industrie, diese in aller Welt geachteten Männer, in die Fänge der Hitlerscheu Politik gerieten? Was hat diese gebildeten, großbürgerlich geprägten Wirtschaftsführer dazu gebracht, sich immer mehr und immer tiefer auf die verbrecherischen Ziele dieses Regimes einzulassen? Und was schließlich hat sie, als alles offenbar und vorbei war, befähigt weiterzumachen, als sei nichts passiert, wiedereinzutreten in die Geschichte, vor der sie ein für alle Mal diskreditiert zu sein schienen?
Bernhard Sinkel hat den Weg dieser Männer behutsam nachgezeichnet. Die Kardinalfrage stellte sich schon früh, lange vor Hitler. Muss jemand, der Giftgas erfindet und herstellt, nicht auch ein Interesse an seiner Anwendung haben?
In den dreißiger Jahren begann dann das Drama einer Verführung, vor allem verbunden mit zwei Erfindungen, die ebenso bedeutsam wie nutzlos zu sein schienen: der Entwicklung von Kunstgummi (Buna) und der Kohlehydrierung (Benzin aus Kohle). Für beide Produkte gab es keinen Markt, denn Kautschuk und Öl waren billiger und weltweit reichlich vorhanden. Erst Hitlers Autarkiestreben machte aus industriellen Flops die Erfolge. Auf diese Reihenfolge kommt es an: Nicht das Autonomiebedürfnis schuf sich den Rohstoffersatz, sondern der Ersatz erfand sich die Autarkie, unter der allein er zum industriellen Hit werden konnte. Welche Wirtschaftsführung hätte da widerstehen können? In einem Augenblick, da die Weltmärkte zusammengebrochen waren, kam einer und sagte, ich will das Produkt, koste es, was es wolle. Mag die Frage weiterhin umstritten sein, ob und wie sehr die deutsche Industrie geholfen hat, Hitler an die Macht zu bringen – umgekehrt gibt es keinen Zweifel daran, dass Hitler zumindest Teile dieser Industrie groß und stark gemacht hat.
Sinkel schildert den Akt der Verführung über die (fiktive) Figur des Heinrich Beck (Bruno Ganz). Beck war alles andere als ein Nazi. Er war ein genialer Chemiker, Nobelpreisträger, sensibel, gebildet, aber auch ehrgeizig, karrierebewusst. Er vor allem treibt die Entwicklung der Hochdruckchemie voran bis in immer gigantischere Dimensionen. Unter seiner Leitung entsteht im besetzten Polen schließlich jenes Chemiekonzentrat, das, weil die Arbeiter dafür zunächst aus dem Stammlager und später aus dem eigens dafür errichteten I.G.-Lager Auschwitz kamen, zum Hauptpunkt der Anklage vor dem Nürnberger Gericht werden sollte.
An Beck erfahren wir auch den doppelten Vorgang der Verdrängung, der Schuld nicht zulassen mochte, weil er schon die Tat nicht ins Bewusstsein vordringen ließ. In Väter und Söhne" wird erlebbar gemacht, wie es dazu kommen konnte, dass verdienstvolle und ehrbare Männer und Frauen zu Helfern der Henker werden und dann, unberührt von Schuld und ohne Zeichen von Scham, weiterleben konnten.
Wir, die Spät- und Nachgeborenen, haben diesen Männern viel zu verdanken, denn das Fundament unseres Wohlstandes ist ihr Werk. Wir gehen durch Straßen, die ihren Namen tragen, und demonstrieren auf Plätzen, die sie gebaut haben. Was gibt uns das Recht, ihnen ein mangelndes Schuldgefühl vorzuwerfen, da wir es doch sind, die vom Gang der Geschichte profitieren?
„Väter und Söhne" erinnert uns an die fortwährende Gegenwart der Vergangenheit. Der Film lehrt uns, dass die Nazi-Zeit noch nicht Geschichte ist, sondern Teil unseres Lebens, das zu begreifen er uns helfen könnte.
„Väter und Söhne" ist ein sinnlicher und abenteuerlicher Exkurs über Verdrängung. Er wählt seine Demonstrationsobjekte im Fundus der Geschichte und bleibt uns dennoch dicht auf den Fersen. Der Film gewinnt seine ärgerliche Aktualität durch den Umstand, dass er Verdrängung in einem Augenblick diskreditiert, in dem diese ihre Fähigkeiten als Mittel der Überlebensstrategie voll entfaltet: Der „Kriegsartikel" gute Laune hat wieder einmal Konjunktur. So spiegelt sich der Film in den Bedingungen seiner Rezeption und wird damit selbst die Geschichte, die zu beschreiben er vorgibt.
München, im Juli 1986
Günter Rohrbach
Aus: „Väter und Söhne. Eine deutsche Tragödie“,
Verlag: Athenaeum, Bodenheim (1986),
ISBN-13: 978-3761084168
Homepage • Vita • Kinofilme • Fernsehfilme • Bücher • Opern • Alf Brustellin • Kontakt
